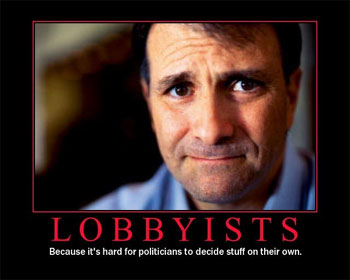 Interessenvertreter vertreten Interessen. Daran ist an sich nichts auszusetzen. Allerdings greifen sie gelegentlich zu Argumenten, die – ökonomisch gesehen – absurd sind. In der letzten Woche bin ich zwei schönen Beispielen aus dem Umweltbereich begegnet.
Interessenvertreter vertreten Interessen. Daran ist an sich nichts auszusetzen. Allerdings greifen sie gelegentlich zu Argumenten, die – ökonomisch gesehen – absurd sind. In der letzten Woche bin ich zwei schönen Beispielen aus dem Umweltbereich begegnet.
Beispiel 1: Schneekanonen
Eine bewährte Methode zur Gewinnung staatlicher Subventionen besteht darin, einen Service Public zu erfinden. Diesem Rezept ist ein Bündner Politiker gefolgt, der letzte Woche tatsächlich im Fernsehen behauptete, dass der Betrieb von Schneekanonen ein Service Public und folglich von der öffentlichen Hand zu finanzieren sei.
Aufgrund ihrer negativen Externalitäten für die Umwelt – Energie- und Wasserverbrauch, Störung der Vegetation, Lärm, Verschandelung der Landschaft – müsste man Schneekanonen eigentlich im ganzen Alpenraum besteuern. Damit würde dem absurden Wettrüsten der Skigebiete zulasten der Umwelt Einhalt geboten: vgl. Beobachter, 2003.
Der Lobbyist verlangt im Dienste seiner Talschaft aber das genaue Gegenteil. Damit wird einzig das bestehende Überangebot an Seilbahnen zementiert. Unrentable Anlagen werden zulasten des Steuerzahlers künstlich am Leben erhalten.
Beispiel 2: Littering
Schweizer Städte wollen vermehrt die Anbieter von „Essen über die Gasse“ (neudeutsch Take Aways) zur Kasse bitten. Gemäss dem Bundesamt für Umwelt, verursacht das „Littering“ (altdeutsch Abfallwegwerfen) von Take-Away-Abfällen jährlich Reinigungskosten von 73 Mio. CHF, welche von den städtischen Steuerzahlern berappt werden.
Gemäss Verursacherprinzip ist es angezeigt, die Verkaufsstellen entweder zur Reinigung zu verpflichten oder ihnen die entstehenden Kosten zu überwälzen. Die Stadt Bern hat dies versucht, aber Detailhändler, u.a. Migros und Coop, klagten dagegen. Und ein gewiefter Lobbyist wehrt sich vor der Kamera von 10vor10.
Der Geschäftsführer von Bern City, dem städtischen Detaillistenverband, glaubt mit einem banalen, legalistischen Argument die Verantwortung abwälzen zu können. Die Verkäufer seien „zum Zeitpunkt der Entsorgung nicht Inhaber der Verpackung, des Gebindes oder des PET-Fläschchens.“
Wie bitte? Die Verkäufer machen enorme Umsätze und wohl auch Gewinne mit den Mitnahmeessen. Wenn sich ihre Kunden nicht umweltgerecht verhalten, sind die entstehenden Kosten in die Preise einzurechnen. So einfach wäre das.
Weil bei etwas höheren Preisen aber die nachgefragte Menge sinkt (in Abhängigkeit der Preiselastizität der Nachfrage), wehren sich die Detaillisten. In Bern waren sie vor dem Verwaltungsgericht mit ihrer Klage gegen die neue Gebührenordnung erfolgreich, sodass die Stadt inzwischen vor das Bundesgericht gezogen ist.
Die Frage lautet, ob eine Finanzierung der Abfallentsorgung in diesem Falle durch höhere Steuern oder Abgaben zu erfolgen hat. Ökonomisch gesehen ist die Antwort klar: Nur das Verursacherprinzip vermag die richtigen Anreize zu setzen. — Wir dürfen gespannt sein, wie viel unser höchstes Gericht von Ökonomie versteht…
